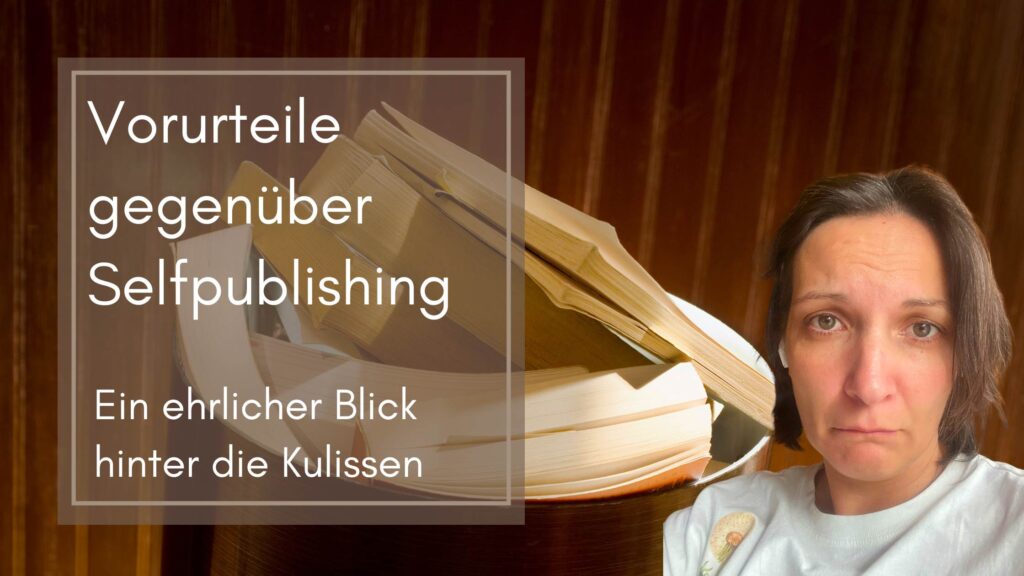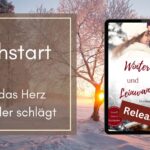Neulich stellte ein Kollege in den sozialen Medien eine durchaus provokante Frage:
Wie professionell sind Bücher eigentlich, die im Selfpublishing erscheinen?
Die Reaktionen waren gespalten – was nicht überraschend ist. Auf Instagram blieb das Feedback überwiegend freundlich, offen, verständnisvoll. Aber auf Facebook schlug mir beim Lesen der Kommentare eine solche Welle an Empörung und Pauschalkritik entgegen, dass ich nach dem 10. Kommentar die App schließen musste.
Maximal 2 % der Selfpublishing-Bücher seien qualitativ mit Verlagsbüchern vergleichbar.
Der Rest? Voller Fehler, ohne Lektorat, mit grausamen Covern, miserablen Klappentexten, schlecht geschrieben, überhaupt nicht lesenswert.
„Ich kaufe so etwas gar nicht mehr. Wurde zu oft enttäuscht“, äußerte sich eine Leserin. Das hat mich sehr beschäftigt.
Nicht, weil ich Kritik für falsch halte. Sondern weil ich diese Einseitigkeit nicht nachvollziehen kann. Selfpublishing ist nicht gleich mindere Qualität.
Genauso wenig wie „Verlagsbuch“ automatisch für pures Lesevergnügen steht.
Und ich frage mich:
Woher kommt dieser Ärger, diese Erwartung, diese Abwertung – und wie passt sie zur Realität von Autorinnen wie mir?
Inhaltsverzeichnis
Selfpublishing ist einfach – professionelles Schreiben ist es nicht
Es stimmt: Ein Buch im Selfpublishing zu veröffentlichen, ist heutzutage vergleichsweise einfach. Über Plattformen wie Amazon KDP geht das ohne Vorkenntnisse, ohne Investition und mit wenigen Klicks.
Das allein macht jedoch kein erfolgreiches Buch, denn ein gutes Buch erfordert neben einer Idee und grundlegendem Wissen über das Schreibhandwerk Lektorat, Korrektorat, ein ansprechendes Cover und einen sorgfältig formulierten Klappentext.
All das kostet Zeit und Geld, und von beidem nicht gerade wenig. Und dann kommt das eigentlich Schwierige: die Sache mit der Sichtbarkeit.
Denn egal, wie großartig ein Buch ist – wenn niemand davon weiß, wird es sich nicht verkaufen. Und damit meine ich: Es wird vielleicht von der Mama, der besten Freundin und Tante Inge gekauft, aber dann war‘s das!
Selbst mit einem guten Cover, sorgfältiger Überarbeitung, einem Bloggerteam, Testlesenden und einem ordentlichen Anzeigenbudget ist es verdammt schwer, auch nur 100 oder 200 Verkäufe zu erzielen. Rentabel wird ein Buch jedoch erst ab 1.000 Verkäufen. Erst dann kann man davon sprechen, dass es die Kosten für Lektorat, Korrektorat und Coverdesign wieder einbringt.
Das ist die Realität vieler Selfpublisher – und nein, das sind nicht alles „Hobbyschreiberlinge“, die mal eben ein E-Book ins Netz werfen. Die, die ich kenne, gehen mit Herzblut, Ehrgeiz und Respekt ihren Lesern gegenüber an die Arbeit.
Autoren gehören wohl eher zu den Idealisten, die davon träumen, mit ihren Geschichten Menschen nachhaltig zu berühren.
Und Selfpublisher (aber auch Verlagsautoren) leisten diese wertvolle kulturelle Arbeit oft neben Beruf, Familie, Haushalt, chronischer Krankheit, Pflege von Angehörigen oder allem zusammen.
Umso schmerzhafter, solche Kommentare zu lesen.
Natürlich gibt es auch Veröffentlichungen, die überhastet erscheinen. Ja, es gibt mangelhafte Bücher – im SP-Bereich wie auch im Verlagswesen. Es gibt Bücher, die die Lesererwartung nicht erfüllen. Die vielleicht ein paar Fehler zu viel haben.
Aber daraus ein Pauschalurteil abzuleiten, halte ich für nicht gerechtfertigt.
Fehler in Büchern
Immer wieder lese ich z. B. auf Threads Beiträge, in denen gefragt wird, wie sehr Rechtschreibfehler Leser*innen in Romanen stören.
Oft heißt es dann: „Ein, zwei verzeihlich. Aber mehr ist unprofessionell. Dann fliegt das Buch weg.“
Bei solchen Kommentaren ziehe ich den Kopf ein und suche das Weite.
Werfen wir doch mal einen Blick auf die Fakten:
Ein durchschnittlicher Roman mit ca. 400 Seiten umfasst rund 100.000 Wörter.
Professionelle Korrektor:innen sagen: Ein Fehler pro fünf Seiten ist akzeptabel.
Das bedeutet: 80 Fehler im Buch sind kein Zeichen von Schlampigkeit, sondern innerhalb des professionellen Toleranzbereichs.
Perfekte Bücher gibt es nicht. Nicht im SP-Bereich und nicht im Verlag.
Wir sind Menschen. Wir machen Fehler. Selbst nach zwei Lektoratsdurchgängen, drei Runden Korrektorat und fünf Testlesenden kann ein Tippfehler bleiben, ein Komma übersehen werden.
Und das eigentlich Absurde?
Manche der lautesten Stimmen, die sich über Kommas und „grammatikalische Unzumutbarkeiten“ aufregen, schreiben selbst Kommentare, die fehlerhaft sind.
Das ist keine Häme. Das zeigt nur: Fehler passieren uns allen. Und es zeigt auch, dass die erwähnten Fehler vielleicht gar keine Fehler sind, denn die deutsche Rechtschreibung hat ihre Tücken. So erlaubt der Duden in nicht wenigen Fällen zwei unterschiedliche Schreibweisen.
Und vielleicht akzeptieren wir das irgendwann. Vielleicht lernen wir, zu differenzieren. Zwischen einem Buch, das voller Flüchtigkeitsfehler ist – und einem, das sorgfältig gemacht wurde, aber eben nicht perfekt. Vielleicht akzeptieren wir, dass Menschen Fehler machen.
Lesende erwarten Qualität – zurecht!
Natürlich sollen Bücher gut gemacht sein.
Natürlich sollten Autor:innen ihr Bestes geben. Und wenn ich mich so umschaue, dann tun sie das auch. Ich kenne keine ernsthaft schreibende Kollegin, keinen Kollegen, die nicht das Beste aus ihrem Buch machen möchten.
Viele Selfpublisher investieren Hunderte bis Tausende Euro in ihr Werk. Bei Verlagsautoren übernimmt das natürlich der Verlag.
Ein professionelles Lektorat kann mehrere hundert bis tausend Euro kosten.
Ein Korrektorat ist geringfügig günstiger. Ein gutes Cover? Zwischen 100 und 500 Euro.
Werbung, Bloggeraktionen, Lesungen, Buchsatz, Druckproben … das alles kostet Zeit, Geld, Nerven.
Und was bleibt am Ende?
Ein paar Euro pro verkauftem Buch – wenn überhaupt.
Der Großteil der Schreibenden (ob im Verlag oder Selfpublishing) kann nicht vom Schreiben leben. Die meisten zahlen drauf.
Und trotzdem tun sie es – weil sie lieben, was sie tun. Weil sie Geschichten erzählen wollen. Weil sie etwas zu sagen haben.
Was wir stattdessen brauchen
Ich will gar keine pauschale Lobhudelei auf Selfpublisher lostreten.
Ich will auch Leser:innen nicht den Anspruch auf Qualität absprechen.
Ich finde es richtig, Bücher zu kritisieren, wenn sie handwerkliche Schwächen haben. Denn so können die Schreibenden sich verbessern.
Aber was ich mir wünsche, ist mehr Differenzierung. Und mehr Respekt.
Wenn dir beim Lesen eines Buches Fehler auffallen – dann schreib dem oder der Autor:in eine freundliche E-Mail.
Einige Selfpublisher bitten in ihren Danksagungen sogar aktiv darum.
Gerade verlagsunabhängige Autor:innen können Bücher oft innerhalb weniger Tage korrigieren und neu hochladen. Das ist ein Vorteil dieser Veröffentlichungsform.
Ich finde es schade, dass Bücher verramscht oder sogar geklaut werden. Über E-Book Piraterie habe ich hier berichtet. Ist es nicht seltsam, für ein Produkt nur 2–3 Euro zu bezahlen, oder gar nur bei Preisaktionen für 99 Cent oder gar gratis zuzuschlagen, dann aber den Luxus einer C-Klasse zu erwarten?
Ich weiß, Taschenbücher kosten schon mal 14 oder gar 20 Euro. Aufgrund der Druckkosten bleiben bei den Autoren trotzdem kaum mehr als die besagten 2–3 Euro hängen. Brutto, wohlgemerkt!
Und ich frage mich:
Wenn wir irgendwann nur noch KI–Bücher lesen, weil diese gerade auf den Markt kommen, weil der erste KI–Verlag gerade gegründet wurde – ist das dann die fehlerfreie Zukunft, die wir wollen?
Ich bin Autorin. Ich bin Selfpublisherin. Und ich bin Leserin.
Ich will Geschichten, die mich berühren.
Nicht Maschinen, die 1.000 fehlerfreie Seiten ausspucken.
Wenn du ein gutes SP-Buch liest, sag es weiter.
Wenn du ein gutes Verlagsbuch liest, sag es weiter.
Wenn du ein mittelmäßiges liest – gib Feedback.
Und wenn du enttäuscht wirst – gib Feedback und bleibe fair.
Denn am Ende lesen wir alle aus dem gleichen Grund:
Weil Geschichten uns verbinden.
Herzlichst Deine